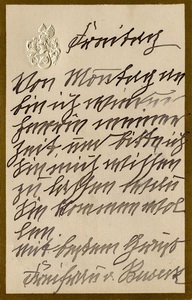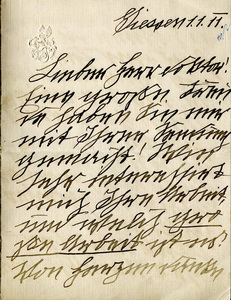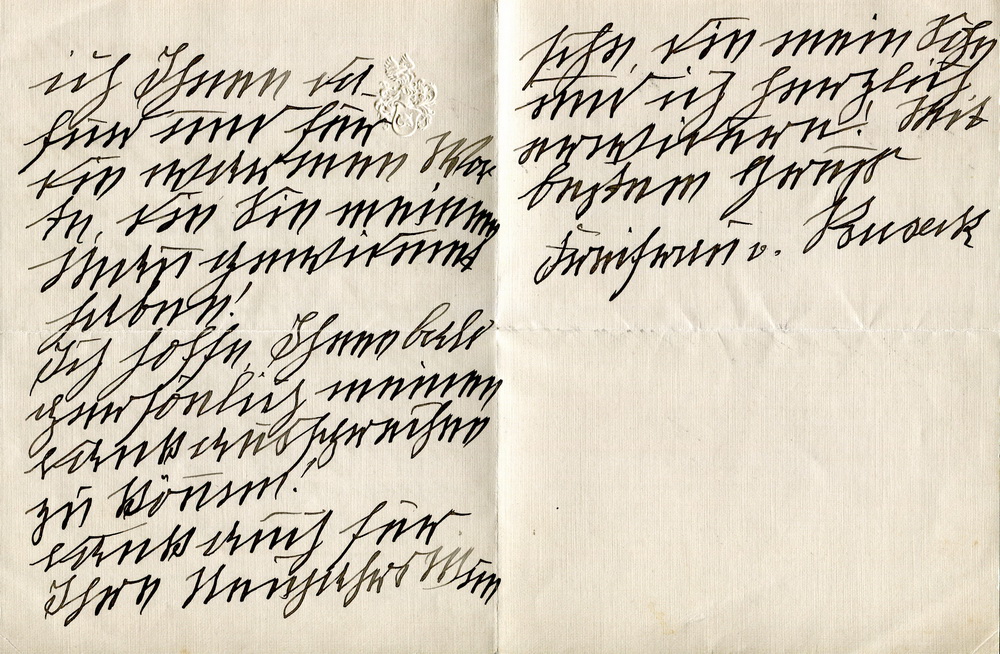|
|
|
|
Dr. Wilhelm Lindenstruth (1885-1918) wurde 1885 in
Beuern als jüngstes Kind des Landwirts Philipp Lindenstruth V. und
seiner Ehefrau Elisabetha geb. Otto in der heutigen Untergasse 7
geboren.
Unweit seines Elternhauses begann für Wilhelm Lindenstruth seine
„wissenschaftliche Karriere“ in der Beuerner Volksschule. Seine
Leistungen müssen auffällig gewesen sein. Ab Anfang 1898 erhielt er vom
Beuerner Pfarrer Otto Schulte zusätzlich Privatunterricht in Latein,
Französisch, Rechnen und Geometrie. So vorbereitet konnte er zu Ostern
1899 in die Unter-Tercia des 'Großherzoglichen Realgymnasiums zu Gießen'
(heutige Liebigschule) wechseln.
Nach einem Studium der Geschichte, deutscher, englischer und Anfangs
auch französischer Sprachwissenschaft, sowie Philisophie und Pädagogik
in Marburg und Gießen promovierte er 1910 in Gießen und legte die
Prüfung für das höhere Lehramt in Geschichte, Deutsch und Englisch ab.
Nur wenige Jahre arbeitete er als Lehrer in Bad-Nauheim und
Idar-Oberstein bevor er 1918, gegen Ende des I. Weltkrieges in einer
Schlacht an der Westfront, tödlich verwundet wurde. |
 |
|
Neben sechs Ausstellungstafeln, die
durch das Leben und die wissenschaftliche Arbeit von Dr. Wilhelm
Lindenstruth führen wurden einige Exponate gezeigt.
|
Das Ehepaar Lindenstruth mit ihren vier Kindern
Wilhelm, Otto Heinrich, Friedrich Carl und Maria (von hinten links).
Repro: Volker Lindenstruth |
|
Der besondere Verdienst von Dr. Wilhelm Lindenstruth
liegt darin, dass er als Erster die Geschichte des Busecker Tales,
dieses kleinen Territoriums inmitten der Landgrafschaft Hessen,
wissenschaftlich aufzuarbeiten begann.
Seine Doktorarbeit zum "Streit um das Busecker Tal" erschien in zwei
Teilen in
den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereines, Neue Folge (=
MOHG NF) 18/1910
und
MOHG NF 19/1911
veröffentlicht. Sie finden
sie in einer moderneren Schriftform (nicht in der für viele bereits
nicht mehr lesbaren Frakturschrift) online:
Teil 1 -
Teil 2
Diese Arbeit hat für die Beschäftigung mit der Geschichte des Busecker
Tales bis heute nicht an Gültigkeit verloren. Wenn das Thema in moderner
Fachliteratur (meist nur am Rande) behandelt wird, so greift man auf
seine Arbeit als Quelle zurück. |
|
Neben seiner Doktorarbeit publizierte Lindenstruth eine
Anzahl kleinerer Aufsätze die sich
zumeist ebenfalls mit der Geschichte des Busecker Tales, seinen
Wüstungen oder Ortsnamensforschung beschäftigen. |
|
|
|
Auswahl der Exponate der Ausstellung: |
|
Vitrine 1:
Ein Zeugnis aus der Zeit auf dem 'Großherzoglichen Realgymnasiums zu
Gießen' zeigt seine Schwäche in Naturwissenschaftlen und Geographie, mit
Stärken in Sprachen und Geschichte - seinen späteren Studienfächern.
Seine fremdsprachlichen Stärken konnten in den damaligen Dorfschulen
weder erkannt noch gefördert werden. Dies geschah damals in den kleinen
Ortschaften durch Privatunterricht besonders begabter Schüler durch die
örtlichen Pfarrer. Erst dieser Privatunterricht ermöglichte diesen
Kindern den Wechsel auf weiterführende Schulen. Dieser Schulbesuch war
zur Zeit von Wilhelm Lindenstruth für die Schüler der Dörfer eine
Ausnahme. Die Lebensplanung der Kinder orientierte sich in der Regel an
den Beschäftigungen der Eltern. So wurden die Jungen Landwirte oder
Handwerker, während die Mädchen für den Haushalt und die Ehe erzogen und
ausgebildet wurden.
Wohl durch die Freundschaft zu den ehemaligen Beuerner Pfarrer und
Privatlehrer Otto Schulte, der 1906 nach Großen-Linden wechselte, lernte
Wilhelm Lindenstruth seine spätere Frau Milli Gutermuth kennen. Emilie
gen. Milli entstammte einer Fabrikantenfamilie in Großen-Linden mit der
Lindenstruth bereits Jahre vor der Eheschließung freundschaftlichen
Kontakt pflegte. Die Heirat der beiden 1913 fand als Doppelhochzeit mit
Millis älterer Schwester und deren Verlobten statt. Den beiden Paaren
war eine Hochzeitszeitung gewidmet.
Einige Bilder des Paares und Millis Eltern zeigen uns das junge Paar.
Die Ehe der beiden blieb kinderlos. Nach Wilhelms Tod nahm Milli eine
entfernte Verwandte ihres Mannes, Margarethe Otto aus Beuern, an Kindes
statt an.
Neben der Sterbeanzeige findet sich in der Vitrine einer der zahlreichen
Nachrufe auf Dr. Wilhelm Lindenstruth.
Lindenstruths unermüdliche wissenschaftliche Beschäftigung mit der
Geschichte des Busecker Tales brachte ihn in Kontakt mit der damals noch
in Gießen lebenden Familie v. Buseck. Diese Familie gehörte ehemals zu
den Herrschern, der Obrigkeit im Busecker Tal. Ihr, inzwischen zum Teil
im Staatsarchiv Darmstadt befindliches Familienarchiv, war für seine
Arbeiten eine wichtige Quelle. Zwei Briefe in der Vitrine zeugen von dem
Kontakt. |
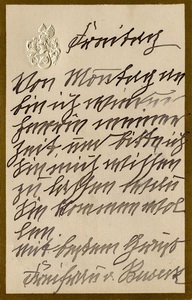 |
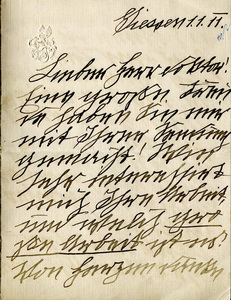 |
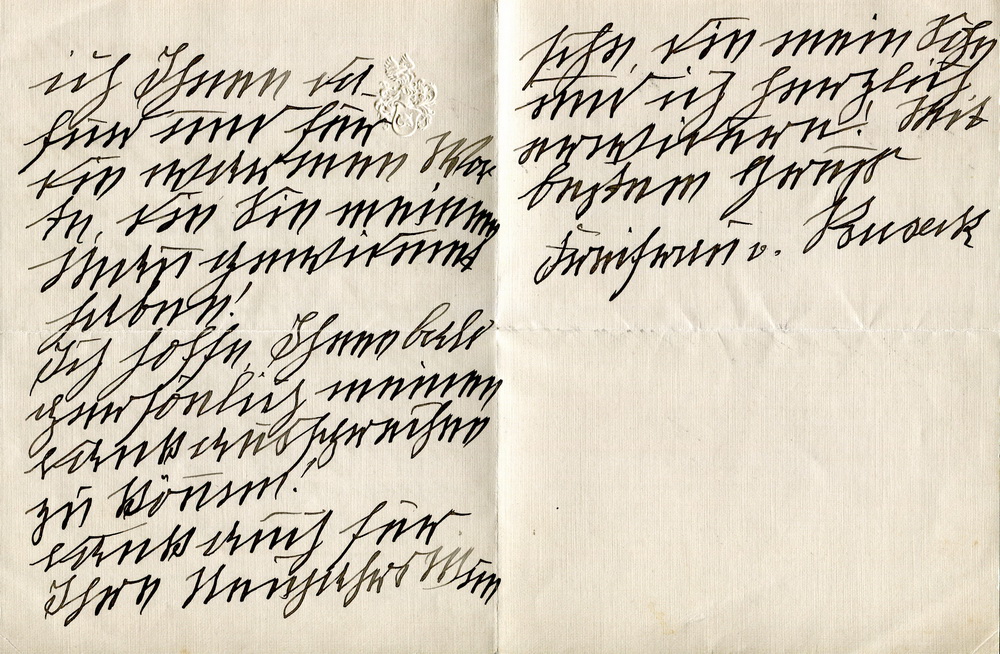 |
|
Karte vom 4. Dezember 1908:
„Freitag
Von Montag an bin ich wieder Herrin meiner Zeit und bitte ich Sie mich
wissen zu lassen wann Sie kommen wollen.
Mit bestem Gruß
Freifrau v. Buseck“
|
Brief vom 1. Januar 1911:
"Lieber Herr Doktor!
Eine große Freude haben Sie mir mit ihrer Sendung gemacht! Wie sehr
interressiert mich Ihre Arbeit, eine ehrlich große Arbeit ist es.
Von Herzen danke ich IHnen dafür und für die weiteren Werke die Sie
meinem Natu gewidmet haben!
Ich hoffe Ihnen bald persönlich meinen Dank aussprechen zu können. Dank
auch für Ihre Neujahrswünsche, die mein Sohn und ich herzlichst
erwidern!
Mit bestem Gruß
Freifrau v. Buseck" |
|
|
|
Ohne Vitrine,
werden die beiden Studentenmützen Lindenstruth und seine
Promotionsurkunde ausgestellt. Daneben eine Auswahl seiner
Schülerzeichnungen, die sein Talent in diesem Fach belegen.
Dazwischen erinnern die Artikel von Harald Klaus aus dem Jahr 2000 über
das Leben und Wirken von Wilhelm Lindenstruth daran, dass die hier
ausgestellten Exponate und zahlreiche Hinweise zu Lindenstruths Leben
aus seiner Sammlung stammen. |
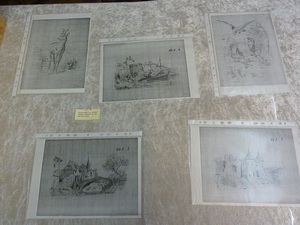 |
 |
|
|
|
Vitrine 2:
Befasst sich mit dem Druck seiner Doktorarbeit.
Als wäre das Verfassen einer Doktorarbeit nicht schon Arbeit genug,
gehört in Deutschland zur Erlangung des Doktortitels die
Veröffentlichung der Arbeit hinzu.
Lindenstruths Arbeit liegt mehrfach vor. Die Ursprungsversion legte er
der Prüfungskommission der Universität vor.
Veröffentlicht wurde die Arbeit in den „Mitteilungen des Oberhessischen
Geschichtsvereines“ 1910 und 1911. Hier war seine Arbeit ein Artikel
unter mehreren im jeweiligen Heft und die Seitenzählung wurde innerhalb
des Heftes fortlaufend weitergezählt. Zur Abgabe als Belegexemplare und
Freundesgaben wurde die Arbeit nochmals separat, jedoch mit eigener
Seitenzählung, gedruckt.
Was heute am PC eine relativ einfache Aufgabe ist, war zu Lindenstruths
Zeit ein aufwendiges Unterfangen: Die Druckfertigstellung einer Arbeit.
Uns liegen in dieser Vitrine, neben den Endexemplaren, Korrekturfahnen
(von Nachfahren seiner Geschwister dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt) in unterschiedlichen Stadien vor. Diese belegen die mühsame
Arbeit während des Herstellungsprozesses einer druckfertigen Arbeit.
In dieser frühen Phase der Drucklegung steht das entgültige Seitenformat
noch nicht zur Debatte. Die Einwände und Einarbeitungen in den Text sind
noch umfangreich. Die späteren Fußnoten finden sich am Textabschnitt.
Später werden sie an das passende Seitenende rutschen.
Neben dem Feilen an der Satzstellung und einer verfeinerten Wortwahl,
geht es auch um die optische Erscheinung. Hier, auf dem Titelblatt, um
einen größeren Zwischenraum zwischen Hauptüberschrift und Untertitel.
|
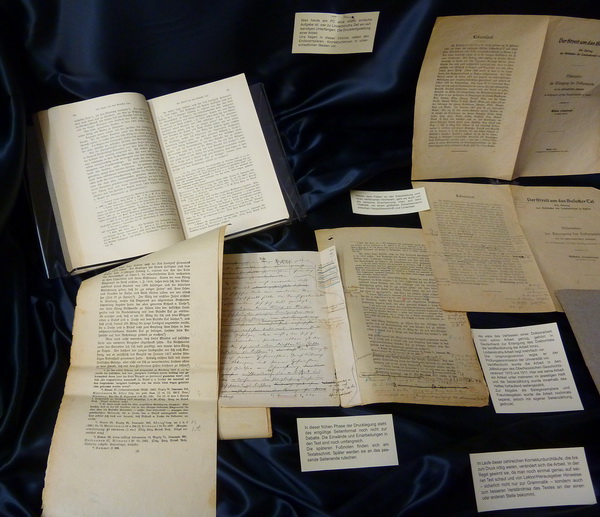 |
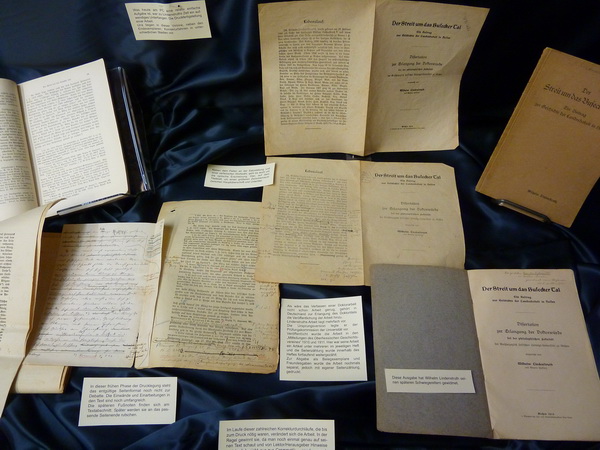 |
|
|
|
Zahlreiche Informationen finden sich auf den
anklickbaren
Ausstellungstafeln |
|
Tafel 1: Herkunft und Ausbildung |
Tafel 2: Studium |
Tafel 3: Geschichtsforschung in Kriegszeiten |
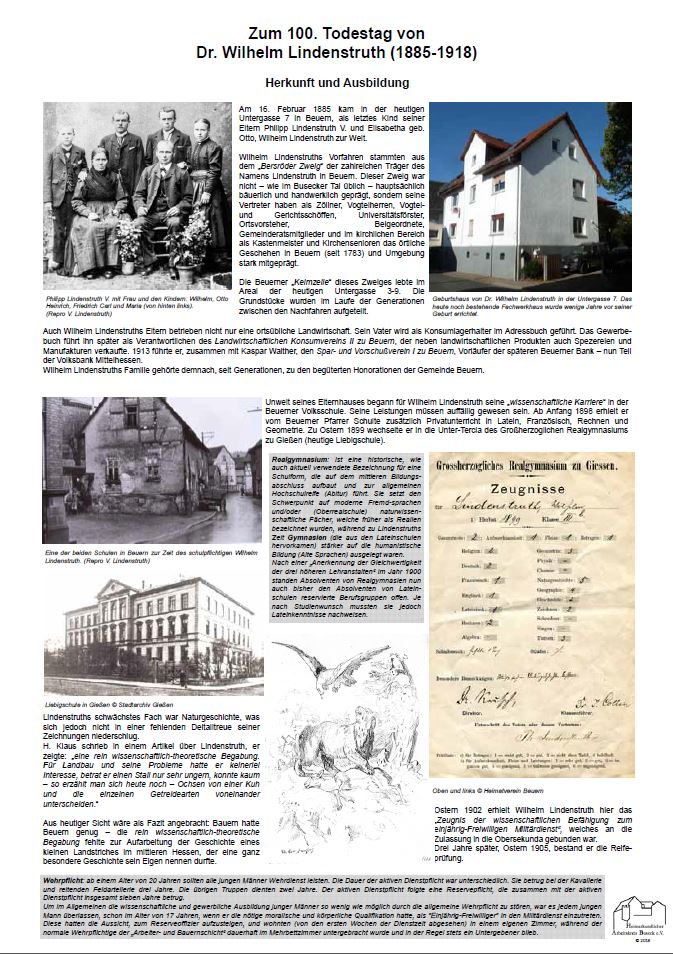 |
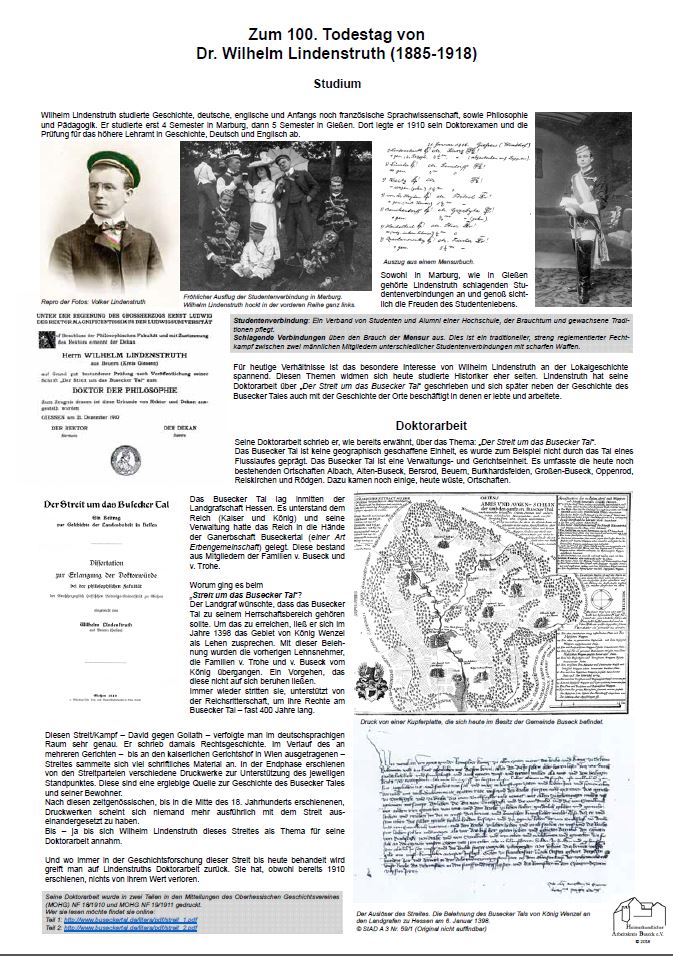 |
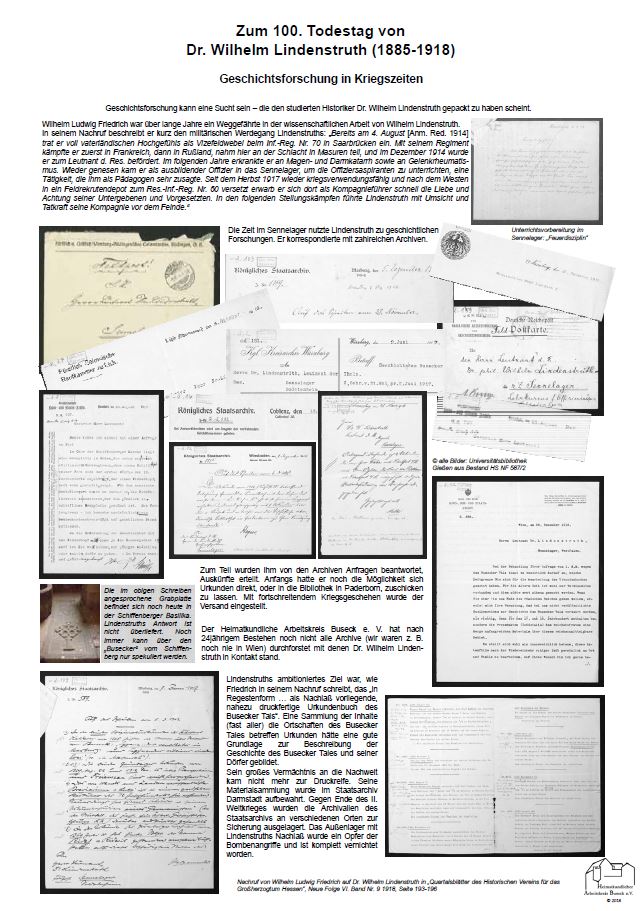 |
|
|
|
|
|
Tafel 4: Publikationen |
Tafel 5: Lindenstruth als Lehrer |
Tafel 6: Rekonstruktion seines vernichteten Nachlasses |
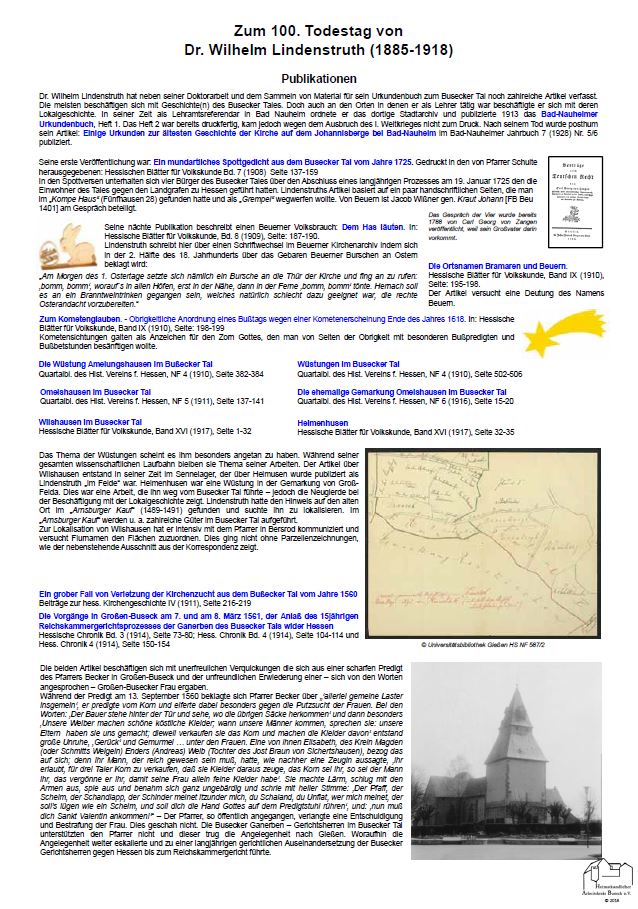 |
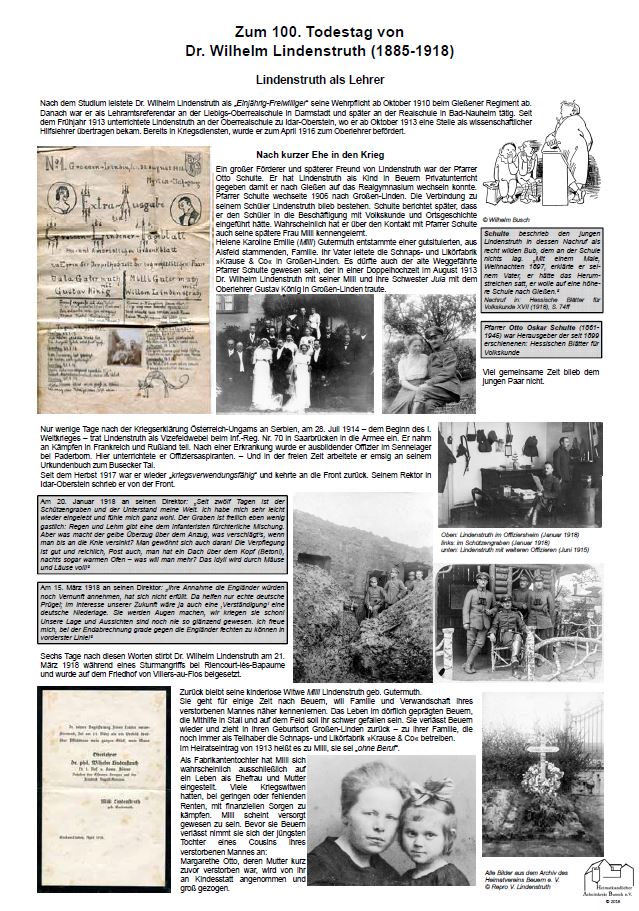 |
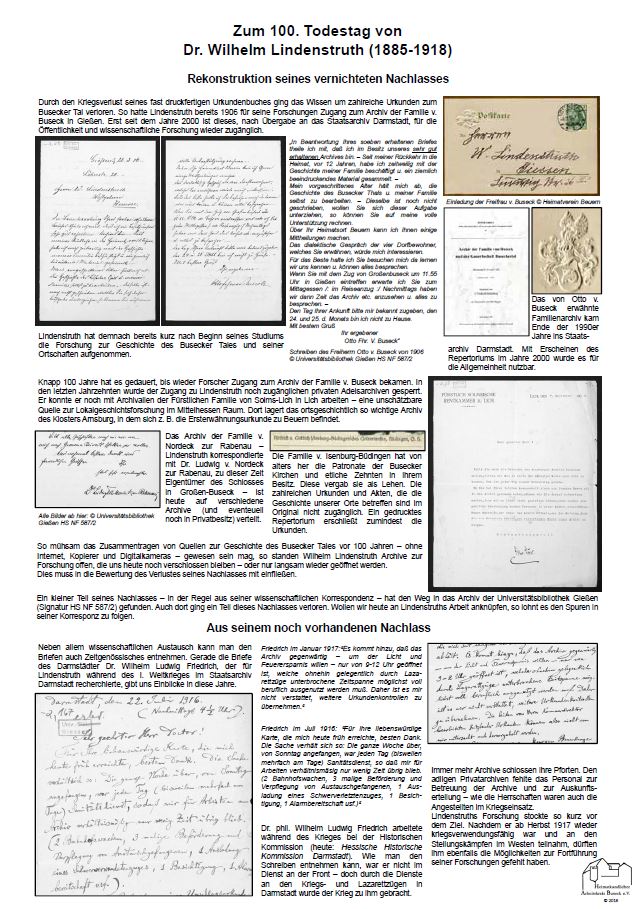 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wir hoffen, Sie haben auf diese Weise einen guten Eindruck unserer
Ausstellung und zum Leben und Arbeiten von Dr. Wilhelm Lindenstruth
bekommen! |